Die Titanenwurz (Amorphophallus titanum (Becc.) Becc.
ex Arcang.)
|
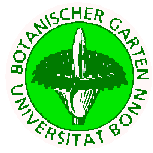 |
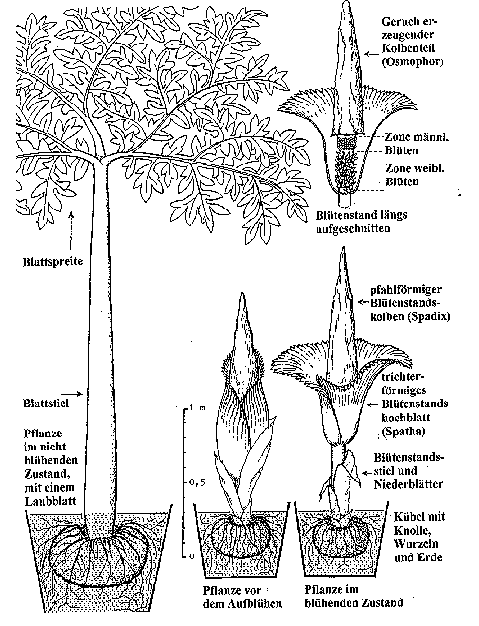
Wie auf der Abbildung links dargestellt, besitzt die Pflanze eine unterirdische, flach-rundliche, bis 75 kg schwere und 60-80 cm breite Knolle, aus der ein einzelnes bis 6 m hohes und beinahe ebenso breites, mehrfach gefiedertes Blatt austreibt. Das Blatt bleibt 9-18 Monate stehen und liefert die Nährstoffe für eine neue, größere Knolle bevor es abstirbt. In unregelmäßigen Abständen von mehreren Jahren wächst anstelle eines Laubblattes ein kolossaler, bis über 3 m hoher und 1,50 m breiter Blütenstand. Der Blütenstand stellt im blütenbiologischen Sinne eine Blume, und zwar die größte im Pflanzenreich dar. Die winzigen männlichen und weiblichen Einzelblüten dieses Blütenstandes sitzen basal an der Blütenstandsachse (Spadix) und werden von einem riesigen Hochblatt (Spatha) umhüllt. Durch ihre Form, ihre dunkle braunpurpurne Farbe und ihren üblen Aasgeruch imitiert die Blume einen verwesenden Tierkadaver und lockt kleine nachtaktive Käfer (Aaskäfer Diamesus spec. und Kurzflügler Creophilus spec.) sowie Bienen an. Die Tiere kriechen über das trichterförmige Hochblatt oder die aufrechte Blütenstandsachse in das Innere der Blume hinab, um dort ihre Eier abzulegen. Dabei übertragen sie den Pollen und bestäuben die Pflanzen. Die ausschlüpfenden Larven der Insekten müssen aber verhungern, da sich ihre Elterntiere von der Titanenwurz haben täuschen lassen. Aus diesem Grunde nennt man Blumen, die ihre Bestäuber nicht entlohnen, Täuschblumen. Der Fruchtstand kann ebenfalls bis 2 m hoch werden. Die zweisamigen, ca. 4-6 cm langen Beerenfrüchte sind leuchtendrot gefärbt und werden von Nashornvögeln (Buceros spp.) gefressen und die Samen dadurch verbreitet (T.M.Everett, Journ.N.Y.Bot.Gard. 1955).
Die Titanenwurz ist ausschließlich auf der Insel Sumatra (Indonesien) zuhause, wo sie als Unterwuchspflanze in Regenwäldern auf kalkhaltigen Böden zu finden ist. Zur Blüte scheint sie allerdings nur an offenen Stellen, Lichtungen oder entlang der Straßen, zu gelangen.
Exemplare der
Titanenwurz sind in botanischen Gärten selten zu finden. Weltweit
haben seit der Entdeckung ca. 30 Pflanzen geblüht, und seit dem II.
Weltkrieg sind Blühereignisse in Deutschland nur aus Bonn, Hamburg,
Mainz, München und dem Frankfurter Palmengarten bekannt geworden.
Die Kultur ist sehr schwierig, und ist u.a. der Grund für die Seltenheit
der Blühereignisse. Die riesige Knolle ist ausgesprochen empfindlich
und wird leicht von Fadenwürmern (Nematoden) befallen, die sie dann
zerstören. Die meisten Blühereignisse wurden von Pflanzen erbracht,
deren Knollen direkt aus Indonesien eingeführt wurden, und in der
Mehrzahl der Fälle starben die Pflanzen nach der Blüte ab, da
die Knollen bereits mit Fadenwürmern befallen ankamen. Professor Kohlenbach
in Frankfurt ging einen anderen Weg, er vermehrte die Titanenwurz meristematisch,
das bedeutet, daß im Labor aus einzelnen Zellen unter sterilen Bedingungen
Pflanzen gezüchtet werden. Er erhielt auf diese Weise 33 Jungpflanzen,
die an verschiedene botanische Gärten, u.a. auch nach Bonn, verteilt
wurden. 1994 blühten hiervon die erste im Botanischen Garten Mainz.
Auch unsere 1996 blühende Pflanze stammt aus Frankfurt.
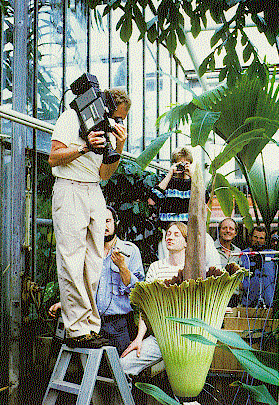
Das Erblühen
der Titanenwurz in Bonn hat schon beinahe Tradition: Das diesjährige
Ereignis ist nach 1937, 1940 und 1987 bereits das vierte. Aus diesem Grunde
wurde als Emblem für unseren Garten die Titanenwurz ausgewählt.
Das Blühereignis 1987 (Abbildung rechts) wurde von zahlreichen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern genutzt, um unterschiedliche
Untersuchungen durchzuführen. Die Ergebnisse werden in Kürze
veröffentlicht. 1987 kamen ca. 10.000 Besucherinnen und Besucher um
die Pflanze zusehen.

An dem Blütenstand der Titanenwurz, die im Mai 1996 (Abbildung links) zur Blüte gelangte, wurden unterschiedliche Messungen, u.a. zum Wachstumsverhalten (siehe Abbildungen unten), durchgeführt: Die ca. 32 kg schwere Knolle wurde am 9.2.1996 getopft und am 8.3.1996 zum erstenmal gegossen. Die Knospe war am 22.3.1996 sichtbar, und die Messungen begannen am 15.4.1996. Zu diesem Zeitpunkt war die Knospe von der Erdoberfläche gemessen 40 cm hoch und 9 cm im Umfang. Sie war umgeben von vier Cataphyllen (Niederblätter). Bis zum Zeitpunkt der Ablösung des äußeren Cataphylls (3.5.1996) verlängerte sich die Knospe mit einer Zuwachsrate von 7-15 cm pro Tag auf eine Gesamtlänge von 195 cm und erreichte einen Umfang von 117 cm. Das innerste Cataphyll löste sich am 5.5.1996, und die Gesamtlänge betrug 216 cm, der Umfang 124 cm. Der Pedunculus hatte am 3.5.1996, eine Länge von 20 cm und verlängerte sich bis zum 5.5.1996 auf 33 cm. Am 6.5.1996 von 22 bis 22.30 Uhr wurde zum ersten Mal ein leichter Aasgeruch abgesondert. Der Geruch war an diesem Tag nur in dieser kurzen Periode wahrnehmbar. Der Blütenstand wuchs weiterhin um 5 cm pro Tag. Am 7.5.1996 konnte eine feuchte Spur am Pedunculus beobachtet werden, diese roch unangenehm und periodisch nach Urin. Der Appendix (steriler Kolbenanhang) strömte zu diesem Zeitpunkt einen pilzigen Duft aus, und die Infloreszenz hatte eine Höhe von 230 cm erreicht. Am 8.5.1996, um 13 Uhr, begann sich die Spatha zu öffnen. Der Blütenstand hatte nun seine Endhöhe von 233 cm erreicht und roch verhältnismäßig harmlos. Die Spatha öffnete sich innerhalb von 5 Stunden komplett, und ihr Durchmesser vergrößerte sich in dieser Zeit von 30 auf 136 cm. Der Pollen wurde am 9.5.1996 um 18 Uhr ausgeschüttet, also 24 Stunden nach der vollständigen Öffnung des Blütenstandes. Um 22 Uhr des gleichen Tages begann sich die Spatha zu schließen, und am 10.5.1996 war sie teilweise dem Appendix genähert. Der Appendix kippte am 12.5.1996 gegen 18.30 Uhr um, wobei die eigentliche Blühperiode bereits am 11.5.1996 abgeschlossen war. Die Temperatur innerhalb der Spatha folgte während der gesamten Zeit der Außentemperatur, eine Wärmeproduktion konnte also nicht nachgewiesen werden. Vom 5. bis 12.5.1996 betrachteten ca. 20.000 Besucherinnen und Besucher die Pflanze.
Von dieser
Pflanze entnahmen wir Pollen. Einen Teil wurde in flüssigen Stickstoff
eingefroren, ein anderer in den Kühlschrank gestellt und ein weiterer
ins Gewächshaus. Nach ca. drei Wochen erblühte ein zweites, wenn
auch kleineres Exemplar, der Titanenwurz in Bonn. Während der karpellaten
Phasen dieser Pflanze erfuhren wir von einer weiteren Pflanze, die zu dieser
Zeit im Frankfurter Palmengarten blühte und sich in der staminaten
Phase befand. Nun konnten wir das Bonner Exemplar mit frischen Pollen des
Frankfurter Exemplars bestäuben. Wir verwendeten auch den eingefrorenen
Pollen und gaben ihn auf definierte Bereiche des karpellaten Bereichs der
Pflanze. Der Fruchtstand entwickelte sich hervorragend und wurde 1 m hoch
und besaß einen Umfang von ca. 60 cm. Die Beeren waren leuchtend
rotorange und bis 4 cm lang. Wo nun sterile und fertile Beeren sitzen konnte
zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgestellt werden.
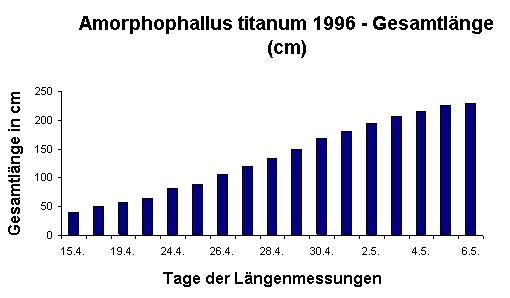 |
|
 |
Botanischer Garten der Universität Bonn
Meckenheimer Allee 171
53115 Bonn
Tel.: 0228-732259
Fax: 0228-733120
Direktor: Professor Dr.Wilhelm Barthlott
Text: Stephan Ittenbach und Dr.Wolfram Lobin
Zeichnungen: Dr. Klaus Kramer
Mai 1996
![]() Zurück
zu den bemerkenswerten Pflanzen
Zurück
zu den bemerkenswerten Pflanzen Zurück
zur Homepage
Zurück
zur Homepage
Stand 16. Dezember 1998, URL: http://www.botanik.uni-bonn.de/botgart/amorpho.htm
Wolfram
Lobin
© Botanischer Garten Bonn 1996, 1998