"Pflanzen der Bibel"
Ausstellungsprojekt im Jahr 2000
Pflanzen des Monats
| Botanisches | Historisches | Biblisches | Andere Details
- zum Logo |
Internet-Links
|
| Die Papyrus-Staude |  Papyrus: aufgefächerter
Blatt- und Blütenansatz (162
KB; Foto: Ekhoff) Papyrus: aufgefächerter
Blatt- und Blütenansatz (162
KB; Foto: Ekhoff) |
„Papyrus" ist ein Wort, das ursprünglich aus dem Ägyptischen entlehnt ist und in das Griechische aufgenommen wurde (papyros). Über die lateinische Sprache ist es dann auch in die deutsche gelangt; abgeleitet davon ist der Begriff „Papier".
Diese Entwicklungslinie, die Jahrtausende umfasst, zeigt bereits an, dass die Worte „Papyrus" und „Papier" etwas sehr Wichtiges bezeichnen. Für die entsprechenden Kulturkreise geht es um die Grundlagen: nämlich um die schriftliche Weitergabe von Wissen und Erfahrungen früherer Generationen an die späteren! Das Material dieser Pflanze bildet im wahrsten Sinne des Wortes eine entscheidende Grundlage des Schreibens und der Schriftüberlieferung. Denn aus der Papyrus-Staude wird ein wichtiges Grundmaterial gewonnen, auf dem Menschen im Altertum geschrieben und aus dem sie gelesen haben.
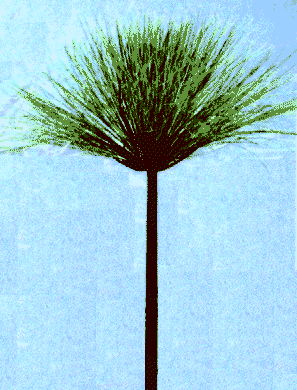 Als moderne botanische Bezeichnung der Papyrus-Staude findet sich in
den Fachbüchern „Cyperus papyrus". Seit der Zeit des großen Arztes
und Naturforschers Carl von Linné (1707-1778) werden Tiere und
Pflanzen mit einer solchen doppelten Benennung versehen. Sie
bezeichnet in einem hierarchisch geordneten System (Stamm / Klasse /
Ordnung / Familie / Gattung / Art) die beiden unteren Ebenen der
„Gattung" und der „Art". Die nächst höhere Ebene für „Cyperus
papyrus" bildet die Familie der Riedgräser-Sauergewächse bzw.
lateinisch: „Cyperaceae" (siehe dazu den Fachartikel in „Blütenpflanzen
der Welt").
Als moderne botanische Bezeichnung der Papyrus-Staude findet sich in
den Fachbüchern „Cyperus papyrus". Seit der Zeit des großen Arztes
und Naturforschers Carl von Linné (1707-1778) werden Tiere und
Pflanzen mit einer solchen doppelten Benennung versehen. Sie
bezeichnet in einem hierarchisch geordneten System (Stamm / Klasse /
Ordnung / Familie / Gattung / Art) die beiden unteren Ebenen der
„Gattung" und der „Art". Die nächst höhere Ebene für „Cyperus
papyrus" bildet die Familie der Riedgräser-Sauergewächse bzw.
lateinisch: „Cyperaceae" (siehe dazu den Fachartikel in „Blütenpflanzen
der Welt").
| Familie | Cyperaceae - Riedgewächse - Sauergräser | rund 90 Gattungen; etwa 600 Arten, die zu dieser Familie gehören, sind in tropischen, sub-tropischen und gemäßigten Zonen der Erde zu finden (tropisches Mittel-Afrika, südlich bis Angola und Zimbawe, Madagaskar; in Ägypten, Syrien und Israel sowie in Sizilien eingebürgert). |
| Gattung | Cyperus | eine der 90 Gattungen verweist mit ihrem Namen auf die Insel Zypern im östlichen Mittelmeer (Zyperngras). Als Zimmerpflanze ist in Nordeuropa ein „Zyperngras" (Cyperus involucratus) verbreitet, das ebenfalls als eine von 50 Arten zu dieser Gattung gehört. |
| Art | papyrus | Papyrus findet sich sowohl in tropischen als auch gemäßigten Bereichen; in Israel / Palästina |
Bilder:
| Standort | Der Papyrus ist eine Sumpfpflanze, wächst in sehr seichtem
Wasser und bevorzugt einen hellen bis sonnigen, ganzjährig
warmen Standort. In milden Klimaten kann er zu einer der
prächtigsten Wasserpflanzen heranwachsen. In Kultur ist sie eine Warmhauspflanze, die es gerne hell bis sonnig und windgeschützt mag. Auch im Winter sollte der Standort möglichst hell bei einer hohen Luftfeuchtigkeit sein. |
| Boden-Substrat |
|
| Licht - Wärme |
|
| Vermehrung | Die Blattschöpfe mit 3 - 5 cm langen Stielteilen werden abgeschnitten und ins Wasser gelegt. Sie bewurzeln sehr schnell. Beim Umpflanzen ist eine Vermehrung durch Teilung der Pflanzen möglich. |
Eigenschaften - äußerlich / innerlich
Habitus
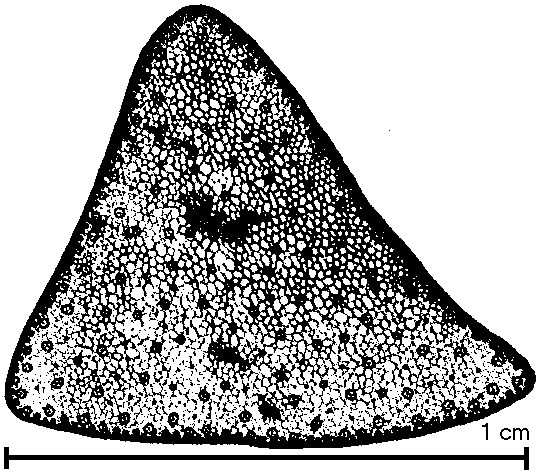 |
|
| Blätter | Der Halm ist kahl und an seiner Spitze befindet sich eine schirmartige Krone von Blättern. Diese schopfartige angeordneten Blätter sind fadenförmig ausgebildet und wirken sehr attraktiv (siehe dazu das Foto Papyrus: aufgefächerter Blatt- und Blütenansatz von oben (169 KB; Foto: Boye). |
| Blüte - Frucht | Im Sommer bis Herbst tragen die Halme große Büschel feiner Ästchen, auf denen die winzigen braunen Blüten in großen doldenartigen Blütenständen stehen. |
| Wurzel | siehe oben Habitus |
| Inhaltsstoffe | Zellulose, Pflanzengummis (= Leim) |
Die Papyrusstaude war im Altertum in Unterägypten weit verbreitet. Heute ist sie dort fast ausgestorben und nur noch in Nubien und am Oberlauf des Nil, ihrer ursprünglichen Heimat zu finden.
In Altägypten wurde sie vor allem als billiges Nahrungsmittel (Rhizom), außerdem als Baumaterial für Wasserfahrzeuge, Segel, Matten und Netze verwendet; aus ihr wurden Seile, Kleider und Haushaltsgegenstände hergestellt. (Herodot, Theophrast, Diodor)
Wandgemälde aus dem 4. Jahrhundert vor Christus zeigen die Papyrus-Ernte. Altägyptische Götterbilder wurden mit Papyrusblüten geschmückt. In der Architektur findet man eine ägyptische, der Form der Papyrusstaude ähnliche Säulenform wieder, die auch Papyrussäule genannt wird.
Die Ägypter stellten als Schreibmaterial Papyrusrollen her. Bis zum 6. Jahrhundert, als dieses widerstandsfähige und dauerhafte Schreibmaterial durch Pergament abgelöst wurde, versorgten sie die Kulturwelt des Mittelmeeres mit verschiedenen Papyrussorten.
[Detailinformationen über Papyrus in der Antike bietet der Lexikonartikel „Papyrus" (aus: Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden. (dtv) München 1979, Bd. 4, Sp. 496-498 ]
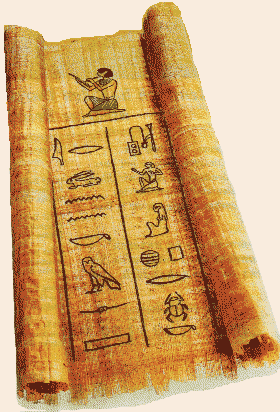 |
In einer alten Anzeige der „Deutschen Post" steht neben der
Abbildung einer (für Touristen hergestellten) Papyrus-Rolle
und unter der Überschrift „Wer schreibt, der bleibt" der
folgende Text:
Als die alten Ägypter ihre Hieroglyphen auf Papyrus festhielten, da ahnten sie wohl kaum, welche Beständigkeit diese frühen Aufzeichnungen haben würden. Tatsächlich hat das geschriebene Wort in der Geschichte Zeit und Raum überbrückt wie kein anderes Kommunikationsmedium. Und auch heute noch ist die Schrift eines der wichtigsten Mittel, Informationen festzuhalten und weiterzugeben. Denn daß ein Schriftstück mehr als tausend Worte sagt, weiß der verliebte Poet genauso wie der achtsame Geschäftsmann. So gesehen hat sich seit den ersten „Briefen" der Ägypter also nicht viel geändert. Nur, daß heute keine Jahrtausende mehr zwischen Absender und Empfänger liegen. Bei der Deutschen Post AG ist ein Brief inzwischen selten länger als einen Tag unterwegs. Über 500 Jahre Erfahrung machen sich eben bemerkbar. Was immer Sie also zu Papier bringen, können Sie uns ruhig anvertrauen. Dabei bleibt's. |
Anders als es in dieser Anzeige vorausgesetzt wird, ist für das Schreiben in früheren Jahrhunderten und vor allem in der Zeit der Antike wichtig, dass gar nicht jede Person selbst schreiben konnte.
Der Beruf des Schreibers und die Herausbildung einer Beamtenschaft stellt deshalb einen wichtigen Schritt der Entwicklung in einer hierarchisch geordneten Gesellschaft dar:
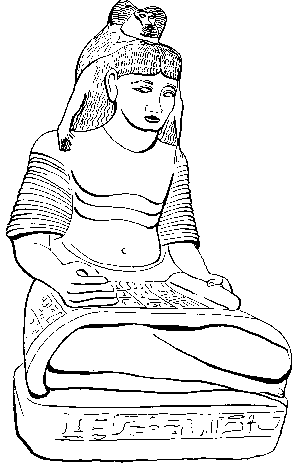 |
Links:
Ein Hoherpriester läßt sich als Schreiber darstellen [Zum Vergleich des Beamtenstands in Ägypten und im Alten Testament finden sich ausführlichere Informationen bei Keel (1984)] Schreiber-Ausbildung (eine Vorläufereinrichtung späterer Schulen) bildet die Voraussetzung der Beamtenschaft. |
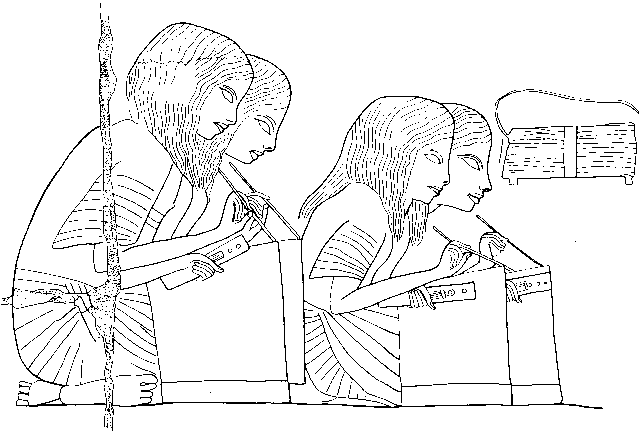 Grabdarstellung in Saqqara nach [Parkinson / Quirke (1995) 36] |
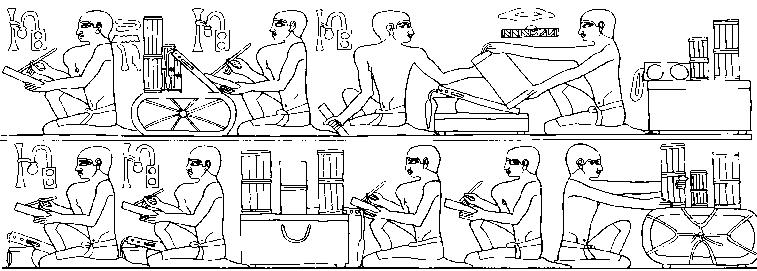 |
Verschiedene
Verwaltungsfunktionen sind
dargestellt: - Schreiber - Schriftrollen- Herausgabe aus einem Archiv - Verwahrung im Archiv |
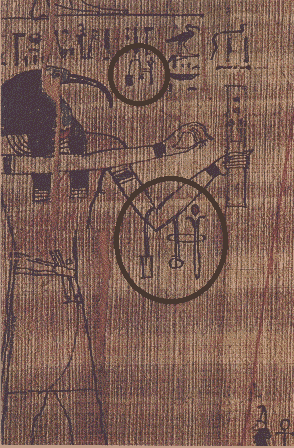 |
(Um die Papyrus-Darstellung ohne die hinzugefügten
Kreismarkierungen zu sehen, hier anklicken)
Dargestellt ist der Ibis-köpfige Schreibergott Thot und Hieroglyphen („heilige Bildzeichen"). In den Kreismarkierungen sind die typischen Gerätschaften eines Schreibers hervorgehoben, die zugleich zu dem Hieroglyphen-Zeichen „schreiben" (kleiner Kreis oben) geführt haben:
(Diese Hieroglyphe ist auch auf der modernen Papyrus-Rolle oben zu sehen. Eine Darstellung aus der Zeit um 2500 vuZ zeigt diese Details noch deutlicher). In der Darstellung auf dem Papyrus hält der Schreibergott selbst wiederum eine Papyrusrolle in der Hand. [Quelle: Claiborne (1978) S. 39] |
Wenn Papyrus-Manuskripte (Manu-skript = Hand-Schrift) vor allem in Ägypten erhalten geblieben sind, so liegt es daran, dass das trockene Klima und der Wüstensand dort oft das Vermodern von pflanzlichen Stoffen verhindert hat. Solche Handschriften, häufig auch kurz Papyri genannt, sind aber in den meisten Fällen trotzdem nicht vollständig erhalten. Bei vielen Funden handelt es sich nur um Bruchstücke, Fragmente bzw. Teile. Sie müssen mühsam zusammengesetzt werden. Oft handelt es sich um einen Zufall, dass und wie Information aus der Antike erhalten geblieben sind. Daraus versuchen Forscher (Papyrologen) wieder ein Bild der Vergangenheit zusammenzusetzen.
| „Papyrus-Recycling": Ägyptische Papyrus-Handschriften wurden zur Einhüllung von Mumien weiterverwertet. Ein Text aus dem Ägytischen Museum, Berlin, beschreibt diesen Zusammenhang und die Rekonstruktion. Ein Bild zeigt einen Papyrusrestaurator und Papyrologen bei der Arbeit (1981). (Text und Bild (67 KB) laden) |
Das griechische Wort papyros wird in der griechischen Bibel verwendet, um eine Pflanze zu benennen, die im Zusammenhang mit Sumpfgebieten genannt wird. Im Jesaja-Buch begegnet eine Schilderung, die von den Sümpfen in Ägypten handelt. In der deutschen Einheitsübersetzung wird diese Stelle wie folgt wiedergegeben:
| Jes 19,6 | Die Kanäle Ägyptens verbreiten üble Gerüche, seicht und trocken sind die Arme des Nil, Binsen und Schilfrohr verwelken. |
Wo das kursiv geschriebene Wort Schilfrohr begegnet, hat der griechische Text papyros. - Fragt man sich nun aber nach dem hebräischen Wort, mit dem Papyrus bezeichnet wird, so steht man vor einer etwas schwierigen Situation. Denn in den drei Fällen, in denen im griechischen Bibeltext von einer Papyrus die Rede ist, steht jeweils im Hebräischen ein unterschiedliches Wort. Außer in Jesaja 19,6 sind es zwei Stellen im Buch Ijob / Hiob, an denen die griechische Version mit papyros übersetzt:
| Ijob 8,11 | Wächst ohne Sumpf das Schilfrohr hoch, wird Riedgras ohne Wasser groß? |
| Ijob 40,21 | Es [ein Tier] lagert unter Kreuzdornbüschen, in dem Versteck von Schilf und Sumpf. |
Ein Rückschluss auf die hebräische Entsprechung der Pflanzenbezeichnung ist deshalb nicht ganz leicht. Vielfach wird das hebräische und aramäische Wort gomä als Bezeichnung für die Papyrus-Staude angesehen, das in den drei schon genannten papyros-Texten nur in Ijob 8,11 verwendet wird. (Möglicherweise handelt es sich auch bei gomä um ein Lehnwort ägyptischer Herkunft(1)). Allerdings kann die genaue botanische Zuordnung nicht ganz sicher sein, denn das (aramäische und) hebräische Wort begegnet in einer Verwendung, die im Zusammenhang ja nicht auf einen genauen botanischen Sachverhalt bezogen ist, sondern etwas allgemeiner „Schilf" oder „Rohr" bezeichnet.
Von den geschilderten Unsicherheiten aus betrachtet kann es nicht verwundern, dass nicht in allen Übersetzungen dieselben Pflanzen-Bezeichnungen verwendet werden. So begegnet z.B. in der Luther-Übersetzung das Wort „Papyrus" überhaupt nicht, während es in anderen deutschen Übersetzungen in Jes 18,1-2 vorkommt.
Im Zusammenhang von Jesaja 18,1-2 geht es um eine Unheilsansage gegen äthiopisch-ägyptische Herrscher. Sie stellen von Ägypten aus eine Bedrohung auch für Israel dar. Besonders der schnelle Schiffsverkehr macht die Politik dieses fremden Volkes bedrohlich:
| Jes 18,1-2
Einheitsübersetzung (1980) |
Weh dem Land der Heuschreckenschwärme jenseits der Flüsse von Kusch. Es schickt seine Boten aus auf dem Nil, in Papyruskähnen über das Wasser. ... |
| Elberfelder Bibel
(revidierter Text 1993) |
Wehe, Land des Flügelgeschwirrs, jenseits der Ströme von Kusch, das Boten auf dem Meer entsendet und in Papyruskähnen über der Wasserfläche! |
| Luther
(revidierter Text 1984) |
Weh dem Lande voll schwirrender Flügel, jenseits der Ströme von Kusch, das Boten über das Meer sendet und in leichten Schiffen auf den Wassern fährt! ... |
Ägyptische Schiffe aus Papyrus sind auf zahlreichen Abbildungen dargestellt. Sie sind gut an dem ebenfalls als Papyrus-Blütenbüschel gestalteten Heck zu erkennen.
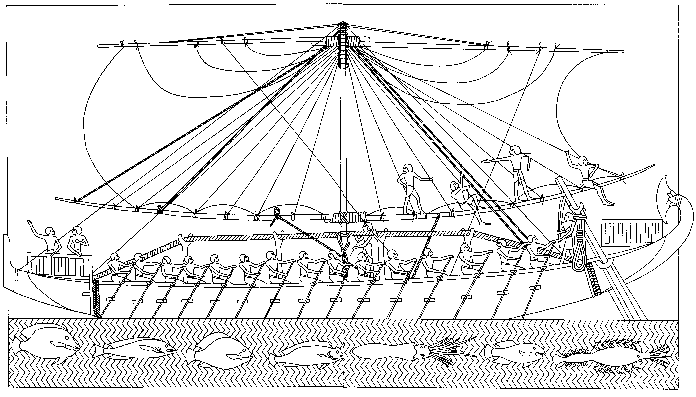 |
Quelle:
Die Seetüchtigkeit von Papyrus-Booten hat Thor Heyerdal´s RA II (123 KB; Kon-Tiki Museum, Oslo) gezeigt. Damit konnte dieser Forscher den Weg von Nordafrika nach Mittel-Amerika zurücklegen. |
Bedenkt man diesen Kontext der Benutzung von Papyrus-Booten, der außerhalb der Bibel in vielen ägyptischen Abbildungen dargestellt wird, so lässt sich für Jes 18,1-2 vermuten, dass auch an dieser Stelle wirklich „Papyrus"-Schiffe gemeint sind.
| 2. Mose / Exodus 2,3 | Als sie es nicht mehr verborgen halten konnte, nahm sie ein Binsenkästchen, dichtete es mit Pech und Teer ab, legte den Knaben hinein und setzte ihn am Nilufer im Schilf aus. ... 5 Die Tochter des Pharao kam herab, um im Nil zu baden. Ihre Dienerinnen gingen unterdessen am Nilufer auf und ab. Auf einmal sah sie im Schilf das Kästchen und ließ es durch ihre Magd holen. |
Wenn der Korb aus gut schwimmbarem Papyrus gedacht wird, so ließe sich in der Erzählung gut verstehen, warum die Mutter zu diesem Ausweg greift. Dass aber Papyrus hier das Material gewesen sein muss, lässt sich deutlich weniger sicher erschließen, als in dem oben geschilderten Text von Jes 18,1-2.
Auch wenn sprachlich eine gewisse Unsicherheit besteht, ob ein Wort - und ggf. welches - als Pflanzenbezeichnung für „Papyrus-Staude" in den hebräischen Texten der Bibel begegnet, so ist ganz sicher, dass biblische Texte auf Papyrus zu finden sind. Für die Schreibkultur im Altertum bilden erhaltene Papyrus-Handschriften ganz wichtige Zeugnisse (siehe dazu Historisches) - und damit auch für die Bibel. Denn wichtige Handschriften oder Teile davon sind auf diesem Material erhalten geblieben.
Die ältesten Belege biblischer Papyri stammen aus den Textfunden in den Höhlen am Toten Meer. In den Höhlen nahe bei der Siedlung Qumran sind Bibelhandschriften gefunden worden, die ca. 1000 Jahre älter sind, als diejenigen, die in den Ausgaben der Hebräischen Bibel zugrundegelegt wurden (siehe dazu: Die Texte von Qumran - Zum gegenwärtigen Stand ihrer Erforschung). Während die meisten der Qumran-Texte auf Lederrollen erhalten geblieben sind, zeigt sich, dass sich im Klima am Toten Meer auch Papyrus noch nicht ganz in seine Bestandteile aufgelöst hat. Allerdings sind es nur wenige der ca. 800 Handschriften, die auf Papyrus die ca. zwei Jahrtausende überdauert haben.
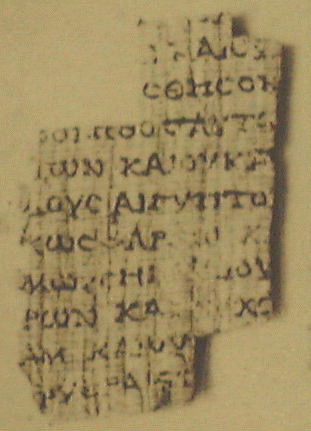 |
Die Abbildung zeigt einen griechischen Text auf
Papyrus aus der vierten Höhle von Qumran
(4Q127). Er ist 1992 in den „Discoveries in the
Judaean Desert" (DJD), Band 9, S. 223- 242,
Fragment 1: 224-225) veröffentlicht worden.
Abgebildet ist das größte von 86 Fragmenten
dieser Papyrus-Handschrift. Sie wird als
Paraphrase zum Buch Exodus bezeichnet
(offizielles Siglum: pap4QParaExodus gr). Der
Text ist bisher unbekannt, aber nahe am Buch
2.Mose / Exodus, wie die lesbaren Bezüge auf
Namen nahelegen:
Ägypten (Zeile 6), Pharao (7), Mose (8) sowie möglicherweis Aaron (9) und Miriam (10) Abbildung aus: A. Schick / U. Gleßmer: Auf der Suche nach der Urbibel, (Oncken) Wuppertal / Kassel 2000, S. 90 [erscheint im März 2000] |
Bei dieser Handschrift handelt es sich zwar nicht um eine biblische Handschrift im engeren Sinne, denn sie stimmt ja nicht mit einem bisher bekannten Text überein. Die Handschrift aus Qumran (aus dem ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung = vuZ) weist aber auf einen Befund hin, der sich auch bei anderen griechischen und hebräischen Bibel-Handschriften zeigt: zu diesem Zeitpunkt gab es noch in stärkerem Maße Unterschiede der biblischen Texttraditionen. Erst später setzen deutliche Tendenzen der Vereinheitlichung ein; dementsprechend sind auch Vorstellungen noch nicht in dieser Zeit vorauszusetzen, wie sie mit den späteren „Kanon"-Entscheidungen verbunden sind.
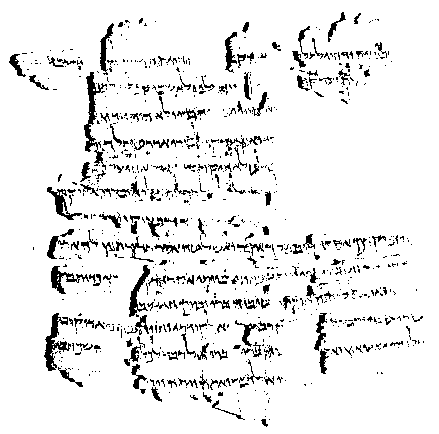 [Allegro 29(B6) ~ PAM 43.175 / FE 1230] |
Ein Beispiel für die Problematik des „Kanon"-Begriffs stellen die Handschriften zum Buch Tobit dar. Dieses Buch ist nur in der griechischen Bibel überliefert und in der Reformationszeit mangels einer Entsprechung in der Hebräischen Bibel aus dem Text der normalen deutschen Bibelausgaben ausgeschieden worden. Im lutherischen Bereich ist Tobit nur in Bibeln mit „Apokryphen" noch zu finden. Die Funde von Qumran zeigen rückschauend, dass es sich um eine zeitbedingte Kanon-Entscheidung gehandelt hat. Denn in der Qumran-Bibliothek erhaltene Handschriften dieses Buches zeigen, dass es sowohl hebräische als auch aramäische Fassungen (neben den zwei griechischen) in der Antike gegeben hat. |
Biblische Papyrus-Handschriften:
Ähnlich wie bei dem oben angeführten Beispiel für ein „Papyrus-Recycling" in Mumien-Kartonage so sind auch Bibel-Handschriften in Ägypten auf diese Weise zufällig wieder ans Licht gekommen. Sie bezeugen die Existenz der griechischen Übersetzung zu den fünf Mose-Büchern für das 2. Jh. vuZ. Die Handschriften-Fragmente „Papyrus Rylands Greek 458" bieten Passagen zu Kapiteln aus 5. Mose / Deuteronomium [Abbildung bei E. Würthwein, Der Text des Alten Testaments, (Deutsche Bibelgesellschaft) Stuttgart 51988, S. 190-191 Nr. 28].
Bibelhandschriften auf Papyrus mit hebräischem Text sind in Ägypten nicht erhalten. Für den griechischen Text des Neuen Testaments bilden jedoch zahlreiche Papyrus-Fragmente eine ganz besonders wichtige Quelle. Die Internet-Links unten erlauben einen Gang durch die Virtuelle Ausstellung der Oxyrhynchus-Papyri bzw. zeigen die Abbildungen des Payrus Egerton 2 im Großformat.
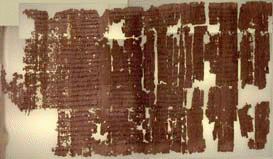 |
Ausstellung der Oxyrhynchus-Papyri in Oxford
(hier abgebildet ist ein Papyrus-Text, der nicht aus dem Neuen Testament stammt. Es handelt sich um eine Kopie des „Töpfer-Orakels", einen eher apokalyptischen Text, der das Ende der griechischen Herrschaft ansagt ) |
Auch z.T. sehr bruchstückhafte Papyri helfen, diejenigen Textfassungen zu rekonstruieren, in denen neutestamentliche und verwandte Texte vom ausgehenden ersten bis zum vierten Jahrhundert im Umlauf waren. Erst danach beginnt die Epoche der großen vollständigen Bibel-Prachthandschriften auf Pergament.
Papyrus-Rollen gehören in der Antike zu den wichtigen Produkten und z.T. zu den Exportartikeln Ägyptens.
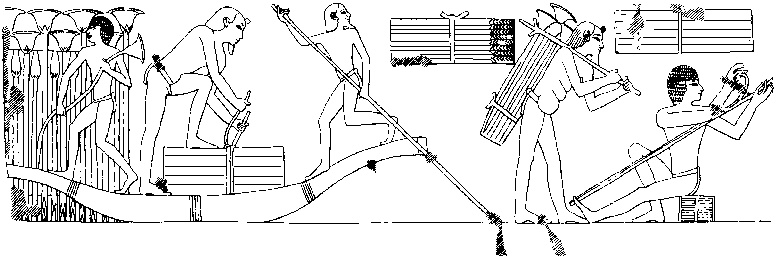 nach einer Darstellung von N. Garis Davies in: Parkinson / Quirke (1995) 13 |
Anleitungen zur Herstellung von Papyrus gibt es in mehreren Büchern sowie auch im Internet (siehe dazu unten; viel Erfahrung steckt hinter der Zusammenstellung bei Hepper (1992) Seite 178-181). Wichtig für das Nachvollziehen dieser Technik mit Papyrus-Stengeln ist dabei der Vorgang des Zerlegens:
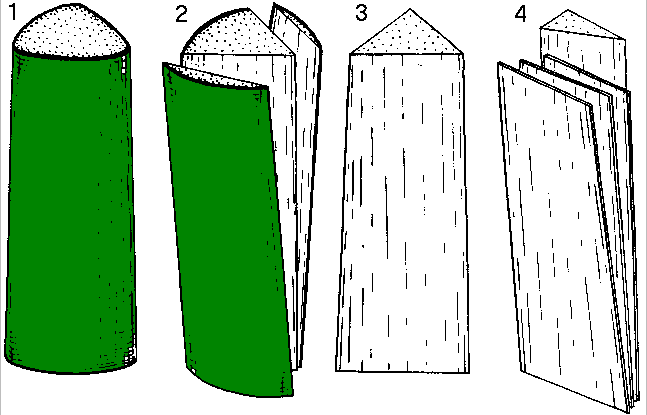 |
|
Anschauliche Zeichnungen der weiteren Bearbeitung sind in dem Buch von Chadefaud / Tarride (1988) Seite 14 enthalten, das die ägyptische Lebenswelt illustriert. In vier Schritten werden dort die wichtigen Arbeitsgänge der Herstellung von Papyrus beschrieben. Sie sind in den folgenden Kästen zitiert:
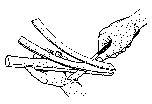 |
|
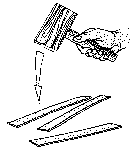 |
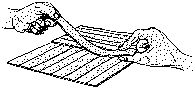 |
|
4.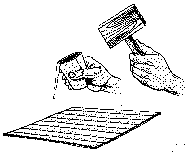 |
| Es wird an andere Blätter geklebt, die auf gleiche Weise hergestellt wurden. So entsteht eine Papyrusrolle, die bis zu 1,50 m lang sein kann. | ||
Allerdings ist bei der dargestellten Technik zu bedenken, dass sie zum Nachvollziehen im unterrichtlichen Zusammenhang nicht sehr geeignet ist. Ein Verkleben ist zudem nicht nötig, da der Pflanzensaft selbst für eine stabile Bindung sorgt. Auch das Hämmern ist mit einer ganzen Klasse wenig praktikabel. Zudem sind 40 cm lange Papyrus-Stücke zwar für antike Rollen ein angemessenes Maß, diese Menge für eine Klasse zu beschaffen, ist jedoch kaum möglich. Es entstehen beim Hämmern eventuell auch Produkte, die dem kostbaren „Pflanzen-Material" nicht angemessen sind und die nicht unbedingt zum Erfolgserlebnis werden. Deshalb bietet es sich an, kleinere Papyrus-Proben zu produzieren und die Pressung durch Rollen sowie ggf. mithilfe von Blumenpressen vorzunehmen.
| Anleitungen | |
| Mit Grundschülern erprobte Schritte (für
eine Unterrichtsstunde) sind auf einem Blatt
als Anleitung zusammengestellt.
(in Anlehnung an eine vom schulbiologischen Zentrum Hannover erstellte Arbeitshilfe) |
Eine Seite mit einer Arbeitsanleitung zur
Papyrus-Herstellung in 12 Schritten
|
| Anleitung zur Papyrus-Herstellung auf Englisch (siehe unten die Internet-Adresse der Universität Michigan) | PB01_eng.html |
Auf einigen Internetseiten sind weitere Detailinformationen zu Papyrus und Papyri zu finden:
| Botanik-Online:
Cyperaceae: Papyrus-Abbildung: |
http://www.rrz.uni-hamburg.de/biologie/b_online/
http://www.rrz.uni-hamburg.de/biologie/b_online/d53/53e.htm#11 http://www.rrz.uni-hamburg.de/biologie/b_online/d53/papyrus.htm |
| Duke Universität | http://scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/texts/homepage.html |
| Das Perseus-Projekt | http://perseus.mpiwg-berlin.mpg.de/
(gespiegelte Daten in Berlin erlauben einen schnelleren Zugriff) |
| Virtual Library Geschichte (mit zahlreichen Links) | http://www.phil.uni-erlangen.de/~p2latein/vl/vlagdt.html
als Teil der „Deutschen Datenquellen": |
| Papyrus Egerton 2
mit Abbildungen und deutscher Übersetzung |
http://alf.zfn.uni-bremen.de/~wie/Egerton/egerton-pictures.html |
| Universität Michigan | http://www.lib.umich.edu/pap/
englische Beschreibung der Herstellung von Papyrus: http://www.lib.umich.edu/pap/introduction/from_egypt_2.html oder in Kopie: PB01_eng.html |
| Oxford - Ausstellung
Oxyrhynchus: A City and its Texts |
http://www.csad.ox.ac.uk/POxy/VExhibition/ |
1. J. Hoftijzer / K. Jongeling (1995) 225 übersetzen gomä mit dem englischen Wort „reed" (Schilfrohr) und verweisen auf einen Vorschlag in der Forschungsliteratur, der eine ägyptische Herkunft des Wortes erwogen hat. Die Diskussion ist jedoch anhand der wenigen Belege kaum zu entscheiden.